Mehr über die Gesellschaft für Exilforschung (including English version).
Widerständiges Schreiben. Lili Körber – Literatur, Politik und Exil
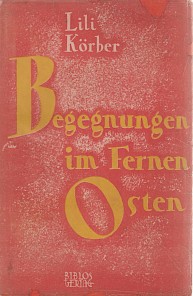
Tagung des Käte Hamburger Kollegs global dis:connect (LMU München) in Kooperation
mit dem Literaturhaus Wien / Österreichische Exilbibliothek, organisiert von Burcu
Dogramaci und Günther Sandner unter Mitarbeit von Veronika Zwerger. 14.-15.11.2024, Österreichische Exilbibliothek im Literaturhaus Wien
Nach dem Lübcke-Untersuchungsausschuss: Was geschieht mit den Akten?
Veranstaltung in der Deutschen Nationalbibliothek in Frankfurt am Main am 25.4.2024 Weitere Informationen
Jahrestagung „Erzwungen und eingeschränkt. Mobilität im Exil“ / „Forced and limited: Mobility in Exile“ (Neuchâtel & Bern, September 2024)
Ausgabe Nr. 62 des Neuen Nachrichtenbriefs

Die Ausgabe Nr. 62, Dezember 2023, des Neuen Nachrichtenbriefs steht als PDF-Datei zur Verfügung.
Wir trauern um unser langjähriges Mitglied Patrik von zur Mühlen (1942-2023)
Der Initiator und langjährige Redakteur unseres Neuen Nachrichtenbriefs Dr. Patrik von zur Mühlen verstarb am 6. Dezember 2023 in Bremen im Alter von 81 Jahren. Mit ihm hat die Gesellschaft für Exilforschung nicht nur eines ihrer ältesten Mitglieder verloren, sondern auch ein langjähriges und sehr aktives Mitglied im Vorstand. Patrik von zur Mühlen übernahm 1993 die Gestaltung des Neuen Nachrichtenbriefs und redigierte ihn zwanzig Jahre lang, ab 2003 in Zusammenarbeit mit Katja B. Zaich.
Exilforschung – Ein internationales Jahrbuch - Band 41/2023: Exil in Kinder- und Jugendmedien
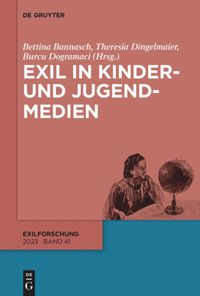
Das Jahrbuch Exilforschung 2023 widmet sich schwerpunktmäßig kinder- und jugendliterarischen Werken, die zwischen 1933 und 1945 entstanden sind und/oder Exilerfahrungen aus dieser Zeit beschreiben. // Weiter lesen
Exilforschung – Ein internationales Jahrbuch - Band 42/2024
Exil und Emotionen - Call for Papers
Die traditionell an Verbannung wie Migration geknüpften Emotionen mit ihren ästhetischen Gestaltungsmustern werden im Literatur- und Kunstschaffen des NS-Exils vielfach aufgegriffen. Gleichzeitig findet darin eine differenzierte Auseinandersetzung mit Emotionen statt, in der die kanonische Verbindung von Exil mit Trauer, Klage, Einsamkeit und Heimweh aktualisiert, reflektiert und erweitert wird. // Weiter lesen
"Herr Fischer, wie tief ist das Wasser?" Inter- und Transmediale Perspektiven auf Kinder- und Jugendmedien des Exils
Tagung in Göttingen, 26./27. September 2024 // Call for Papers
Tagungsbericht online Exil und Frieden. Exil-, Migrations- und Fluchtforschung im Dialog
Jahrestagung 2023 der Gesellschaft für Exilforschung e.V. in Kooperation mit dem Institut für Migrationsforschung und Interkulturelle Studien (IMIS) der Universität Osnabrück vom 21. bis 23. September 2023 in Osnabrück in der Aula des Schlosses zu Osnabrück // Tagungsbericht
Doktorand*innenworkshop im Rahmen der Tagung in Osnabrück am 21. September 2023
Förderung durch das Helen Reinfrank-Vermächtnis
Helen Reinfrank (1915 Berlin – 2011 London) hat in ihrem Vermächtnis die Gesellschaft für Exilforschung e.V. bedacht. Die Zuwendung soll für die Veranstaltung von Workshops eingesetzt werden, auf denen Dissertationsprojekte zum Exil oder zu Fragen der Exilforschung präsentiert werden können. // Weiter Lesen!

